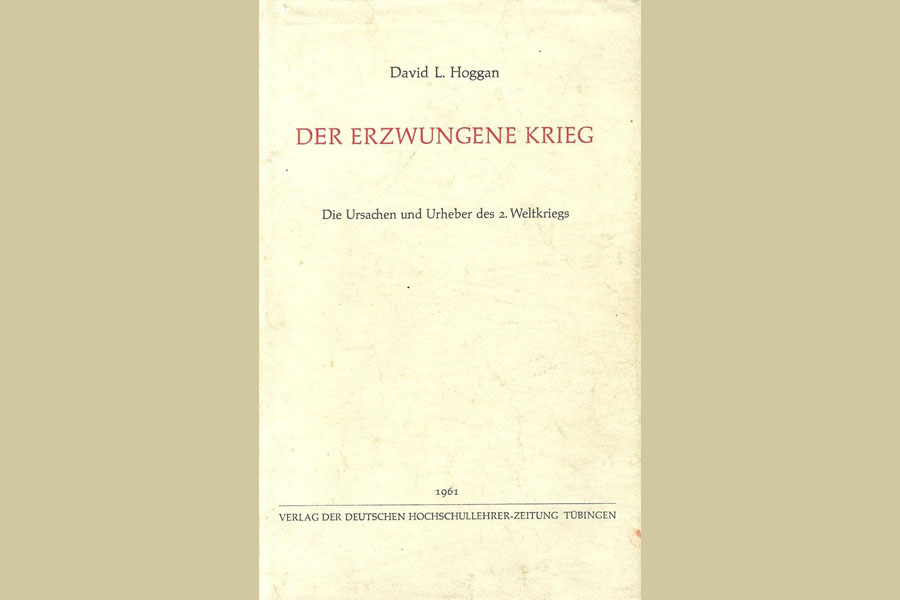
Inhalt
Dachauer Symposium für Zeitgeschichte
Wo sonst sollte eine Tagung zur deutschen Geschichtsverfälschung der Nachkriegszeit stattfinden als im Umfeld einer Gedenkstätte für die nationalsozialistischen Opfer? Das Dachauer Symposium zur Zeitgeschichte existiert seit dem Jahr 2000 und dient dem wissenschaftlichen Austausch über die Geschichte des Nationalsozialismus. Im Herbst 2023 fand es unter dem Schwerpunkt „Rechter Geschichtsrevisionismus in Deutschland: Formen, Felder, Ideologie“ unter der Leitung des Historikers Jens-Christian Wagner statt. Vielleicht ist der Name nicht jedem außerhalb des Wissenschaftsbetriebs bekannt: Wagner ist Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora und fungierte zuvor als Geschäftsführer der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die Geschichtspolitik nach 1945, was ihn im besonderen Maße für die Thematik des Daucher Symposiums im Jahre 2023 qualifiziert.
Doch der Schwerpunkt des Symposiums ist weit über den Wissenschaftsbereich von gesellschaftlicher Relevanz, was mich dazu veranlasste, dessen Ergebnisse, die mittlerweile in einem Tagungsband veröffentlicht sind und den Stand der Forschung darstellen, hier – freilich etwas verkürzt – zusammenzufassen. Als Geisteswissenschaftler, der sich viel in thematisch entsprechenden Online-Medien bewegt, bin ich in den vergangenen Jahren selbst zunehmend mit dem Phänomen der Umdeutung deutscher Geschichte konfrontiert. Es sickert offen in Kultur-Communitys unterschiedlichster Ausrichtung und zeugt von einer beunruhigenden Erosion des Geschichtsbewusstseins. Zugleich ist dies Ausdruck des Rechtsrucks in der Gesellschaft. Umso relevanter sind Projekte wie das an der Friedrich-Schiller-Universität Jena angesiedelte Geschichte statt Mythen, das sich wissenschaftlich fundiert der Dokumentation, Analyse und Einordnung von Geschichtsrevisionismus widmet.
Themenfelder und Akteure des Geschichtsrevisionismus nach 1945
Im Zentrum des rechten Geschichtsrevisionismus stehen die Leugnung und Verharmlosung von NS‑Verbrechen. In seiner Einführung skizziert Wagner seine Entwicklung und die unterschiedlichen Strömungen nach 1945. Sein Ursprung liegt in der NS-Propaganda selbst, wird aber immer wieder den Zielsetzungen angepasst. Als Topoi dienen dabei Erzählungen einer jüdischen Kriegsschuld, eines von Briten und Polen aufgezwungenen Krieges oder der Mythos eines Präventivkrieges gegen die Sowjetunion. Mit der Fokussierung auf den alliierten Luftkrieg (insbesondere die Bombardierung von Dresden), die Vertreibung aus den deutschen Ostgebieten oder die Rheinwiesenlager, in denen deutsche Kriegsgefangene nach 1945 in großer Zahl interniert waren, wird eine Täter-Opfer-Umkehr betrieben. Es ist der Versuch, Kriegsverbrechen gegeneinander aufzurechnen und die nationalsozialistischen Verbrechen zu relativieren. In den 1970er- und 1980er-Jahren kam dann vermehrt die Verharmlosung oder Leugnung des Holocaust auf.
Die Quellen, die in den Erzählungen herangezogen werden, sind allerdings häufig selektiv oder aus dem Kontext gerissen. Bei den geschichtsrevisionistischen Publikationen ist auffällig, dass es sich bei den Autoren meist nicht um Historiker handelt. Eine Ausnahme bildete der Historiker David L. Hoggan, der mit seinen Publikationen, die die deutsche Kriegsschuld relativieren bzw. leugnen, große Popularität in rechten Kreisen besaß. Seine Ansichten sind von der seriösen historischen Forschung längst widerlegt. Ihm konnte nachgewiesen werden, dass seine Schlussfolgerungen auf systematischen Fälschungen von Quellen basierten.
Im Zusammenhang mit der jüngeren Entwicklung rechter Geschichtsnarrative verweist Wagner auf bestimmte immer wiederkehrende Kampfbegriffe wie „Schuldkult“ oder „Nationalmasochismus“, die nicht die Leugnung verfolgen, sondern vielmehr die Wende in der Erinnerungspolitik vorantreiben sollen, wie sie einst AfD-Frontmann Björn Höcke forderte. Überhaupt ist es die AfD, die geschichtsrevisionistische Ansichten und Botschaften in die Gesellschaft trägt. Neben den „Fliegenschiss“-Aussagen von Alexander Gauland oder der SS-Verharmlosung von Maximilian Krah verfangen aber auch die Botschaften lokaler Akteure wie des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der AfD Thüringen, Jörg Prophet. Durch seine Kandidatur zum Oberbürgermeister im thüringischen Nordhausen wurden Prophets geschichtrevisionistische Ausschweifungen auf dem Blog des AfD-Regionverbandes, die sogar in einem thüringischen Verfassungsschutzbericht Erwähnung fanden, einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Sie sind heute gelöscht.

Alte und Neue Rechte
Auch wenn die innere Struktur des Sammelbandes ihn ans Ende bringt, ist es der Beitrag von Maik Tändler über die Abwehrhaltung rechter Akteure gegen die Erinnerungskultur nach 1945, der sich inhaltlich am besten an Wagners generellen Überblick anschließt. Tändler widmet sich den einflussreichen Autoren der alten und neuen Generation rechter Geschichtsrevisionisten. Im Mittelpunkt der Schriften steht dabei die Kritik an der Vergangenheitsbewältigung und Erinnerungskultur in der Bundesrepublik. Es ist der ideologisierte Kampf gegen „Schuldkult“ oder „Nationalmasochismus“. Das Spektrum der revisionsistischen Deutungsmuster reicht von der Relativierung von Kriegsverbrechen über die Kriegsschuldfrage bis hin zur Holocaustleugnung.
Die frühe Generation der rechten Geschichtsrevisionisten bis etwa 1970 speist sich primär aus NS-Parteigenossen, die die Wiederherstellung nationaler Größe und die eigene historische Rehabilitierung verfolgen. Zu Standardwerken dieser Phase wurden Publikationen von Peter Kleist, Armin Mohler, Heinrich Härtle oder Udo Walendy. Die Holocaustleugnung, die auch in den 1970er-Jahren in rechtsextremen Kreisen populär war, konnte aber darüber hinaus keine Verbreitung finden. Anders verhielt es sich mit Veröffentlichungen wie der 1978 erschienenen „Geschichte der Deutschen“ des Historikers Hellmut Diwald, der ein breites Publikum unter anderem davon überzeugen wollte, die Gaskammern des KZ Dachau wären von den amerikanischen Besatzern errichtete Attrappen. Der Holocaust sei durch „bewusste Irreführungen, Täuschungen, Übertreibungen für den Zweck der totalen Disqualifizierung eines Volkes“ ausgebeutet worden. Diwalds in der wissenschaftlichen Fachwelt starker Kritik ausgesetztes Werk kann als früher Meilenstein einer neurechten Geschichtsschreibung gewertet werden, die Vorstellungen von Nationalstolz bis in die Mitte der Gesellschaft transportiert hat.
Es war schließlich Ernst Nolte, der 1986 die Frage nach der Einzigartigkeit des Holocaust in die Wissenschaft trug und einen Historikerstreit auslöste. Nolte sah den Holocaust als Reaktion der Nationalsozialisten auf die vorausgegangenen Massenverbrechen der stalinistischen Säuberungen und die daraus resultierende Angst vor dem Bolschewismus. Das Judentum interpretierte er in diesem Zusammenhang als Kriegspartei, was für Hitler als Legitimation zur Internierung europäischer Juden herangezogen werden könne. Die Debatte um die Singularität des Holocaust erhielt neuerdings eine neue Dynamik durch die Veröffentlichungen des australischen Genozidforschers Dirk Moses, der Deutschland einen Katechismus in der Erinnerungskultur unterstelle. Dabei sind es ausgerechnet Kolonialforscher wie Jürgen Zimmerer, die für eine stärkere globale Perspektive auf den Holocaust plädieren. Ihre Kontinuitätsthese sieht den europäischen Kolonialismus und die nationalsozialistische Expansions- und Mordpolitik als auf ähnlichen Konzepten von Rasse und Raum basierend an.
Covid-Pandemie und Rechtsterrorismus
Fabian Virchow und Imanul Naumann machen im Folgenden auf unterschiedliche Formen des Geschichtsrevisionismus aufmerksam, die bisher nur wenig Beachtung erfahren haben. Virchow verweist auf entsprechende Tendenzen im Zuge der Proteste gegen Maßnahmen in der Corona-Pandemie. Hierbei gingen häufig Verschwörungserzählungen und Geschichtsrelativierung Hand in Hand. Bezugspunkt war wieder der Nationalsozialismus. Es wurden Parallelen gezogen zwischen den Corona-Schutzmaßnahmen und den Handlungen des NS-Regimes. Im Hinblick auf die Impfungen wurden Vergleiche zur Verfolgung und Ermordung von Juden gezogen. Das gipfelte darin, dass sich einzelne Protestler im Widerstand wie Sophie Scholl oder in den Lebensumständen von Anne Frank in ihrem Amsterdamer Versteck sahen.
Naumann zieht in seinem Beitrag eine Entwicklungslinie des wenig beachteten Rechtsterrorismus bis zurück in die Anfänge der Weimarer Republik. Als zentrale Ziele des Terrors nach 1945 seien die Unterbindung der Ahndung von NS-Verbrechen und die Verhinderung der Aufarbeitung der NS-Zeit zu nennen. Beispielhaft zeigt Naumann den Weg des Rechtsextremisten Manfred Roeder nach, der in den 1970er- und 1980er-Jahren zunächst mit der Verbreitung revisionistischen Gedankenguts auffiel und schließlich in den terroristischen Untergrund ging. Roeder wurde unter anderem wegen Holocaustleugnung, Volksverhetzung und Rädelsführerschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt.
Die extreme Rechte und die AfD
Die nächsten Beiträge stehen ganz im Zeichen der extremen Rechten und der AfD, bei denen programmatische geschichtsrevisionistische Narrative zu beobachten sind. Hierfür analysiert Volker Weiß die geschichtspolitischen Positionen und Äußerungen im Umfeld des Instituts für Staatspolitik (IfS), einer privaten Denkfabrik des rechtsextremen Vordenkers Götz Kubitschek, die er gemeinsam mit Karlheinz Weißmann im Jahre 2000 gründete. Das vom Rittergut Schnellroda in Sachsen-Anhalt agierende IfS wurde vom Bundesamt für Verfassungsschutz und dem Landesverfassungsschutz Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem eingestuft und 2024 zugunsten von Nachfolgeorganisationen aufgelöst. Weiterhin aktiv ist der in Schnellroda angesiedelte und ebenfalls als gesichert rechtsextrem eingestufte Verlag Antaios, in dem zahlreiche geschichtsrevisionistische Titel erschienen sind.
Kubitschek knüpft an die Tradition neurechter Vordenker wie Armin Mohler, Bernard Willms oder Rolf Peter Sieferle an. Im Zentrum ihrer geschichtspolitischen Narrative steht eine durch die Siegermächte aufdoktrinierte Vergangenheitsbewältigung Deutschlands nach 1945, die eine „befreiende Normalität“, eine nationale Identitätsbildung verhindern würde. Heldengeschichten und Wertschätzung von Traditionen statt moralischer Verurteilung sollen wieder mit deutscher Geschichte assoziiert werden und zur Normalisierung des Nationalsozialismus beitragen.
Wie tief dieses Gedankengut auch in der AfD, ihren Akteuren, Organen und Institutionen verankert ist, zeigt der Beitrag von Markus Linden. Dabei sind es bei weitem nicht nur die Leitfiguren wie Alexander Gauland mit seiner „Fliegenschiss“-Aussage über die Zeit des Nationalsozialismus oder Björn Höcke mit der Bezeichnung des Holocaustmahnmals in Berlin als „Denkmal der Schande“. Wenn letzterer eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“ fordert, dann ist die geschichtspolitische Schlagrichtung seiner Partei vorgezeichnet. Ihr folgen die Anhänger der AfD, aber auch zahlreiche Politiker aus der zweiten Reihe wie der Historiker Stefan Scheil oder der Journalist und Schriftsteller Michael Klonovsky. Sie üben sich in der Kunst der Relativierung von Diktaturen durch absurde Gleichsetzungen mit liberalen Demokratien („DDR 2.0“, „bunte Diktatur“), wahlweise auch des deutschen Kolonialismus. Insbesondere wird dabei die deutsche Kriegsschuld heruntergespielt oder gar negiert. In diesem Kontext sind auch die Aussagen von Maximilian Krah zu sehen, die die SS zu verharmlosen versuchen.
Medien und Verlage
Der Beitrag von Maik Fielitz und Hendrik Bitzmann widmet sich geschichtsrevisionistischen Erzählungen in rechten Alternativmedien wie Compact, Journalistenwatch, PI-News, Philosophia Perennis oder Deutschland-Kurier. Sie sind in großen Teilen dem Vorfeld der AfD zuzurechnen und sind aus Blogs oder Printmagazinen durch die Reichweite des Web 2.0 zu relevanten politischen Akteuren aufgestiegen. In eine weitere Kategorie von Playern, die überhaupt erst durch die Möglichkeiten des Internets aufgekommen sind, sind Influencer einzuordnen. Die Topoi lassen sich hinsichtlich ihres Bezugspunktes in verschiedene Felder einteilen: Kaiserreich, Kolonialismus, Nationalsozialismus und DDR. Angesichts der hohen Quantität der Beiträge auf diesen Portalen stellen Fielitz und Bitzmann fest, dass Geschichtsrevisionismus darin einen vergleichsweise geringen thematischen Anteil einnimmt und eher als Mittel zum Zweck eingesetzt wird. Die Schlagfrequenz entsprechender Artikel erhöht sich vornehmlich dann, wenn politische und gesellschaftliche Ereignisse eine Aktualität garantieren. Unter dem Schutz von Pressefreiheit garantiert dann Empörung eine hohe Anzahl von Klicks.
Im Anschluss stellt Justus H. Ulbricht die Netzwerke der Neuen Rechten im Verlagswesen vor. Wichtige Scharnierfunktionen haben dabei die Institutionen und Verlage rund um Kubitschek in Schnellroda und die Wochenzeitung Junge Freiheit inne. Letztere ist zudem anschlussfähig an das Weltbild konservativer Kreise der bürgerlichen Mitte. Gleichzeitig schlägt sie die Brücke zwischen nationalkonservativen und rechtsextremen Positionen. Zum Umfeld der rechten Netzwerke gehören neben dem schon erwähnten Compact Magazine und Zeitschriften wie Cato, Tumult, Zuerst und Sezession. Letztere stammt wiederum aus dem Antaios-Verlag in Schnellroda. Welchen Anteil und welche Schwerpunkte diese Blätter im geschichtsrevisionistischen Mix setzen, ist allerdings zukünftig Forschungen zur Ergründung überlassen.
Die Reichsbürgerszene
Zum Abschluss führt Sophie Schönberger in die höchst heterogene Welt der Reichsbürger ein, weshalb es sich im Grunde bereits verbietet, von einer Szene oder Bewegung zu sprechen. Einige Gruppierungen des Milieus machten in den vergangenen Jahren durch Gewaltakte oder spektakuläre Verhaftungen Furore. Bekannt geworden sind Peter Fitzek mit seinem Königreich Deutschland sowie die Putschversuche der Gruppe rund um Heinrich III. Prinz Reuß.
Die ideologischen Kerne dieser Gruppierungen gehen stets von geschichtrevisionistischen Konstrukten aus, die eng mit Verschwörungsmythen verwoben sind. Ausgangspunkt ist die Fixierung auf die Idee einer Besatzungsherrschaft der Alliierten nach 1945, die bis heute fortbesteht. Infolgedessen werden die Existenz der Bundesrepublik Deutschland sowie die Gültigkeit des Grundgesetzes als konstituierende Basis negiert. Man wähnt sich weiterhin im Deutschen Reich, das weiterhin fortbesteht, wobei der Bezug in der Regel nicht zum Dritten Reich, sondern zum Kaiserreich, gelegentlich auch zur Weimarer Republik hergestellt wird. Einige Gruppierungen praktizieren eine Selbstverwaltung, die die Verwaltungsbehörden und staatlichen Organe der Bundesrepublik als nicht legitimiert ansehen. Das führt auch zu Auswüchsen wie dem Ausstellen eigener Ausweisdokumente.
Exkurs: Rechte Erzählungen im Netz
Der oben zusammengefasste Band stellt den aktuellen Forschungsstand und somit den akademischen Blick auf die Thematik dar. Doch viele von uns werden die Erfahrung gemacht haben, dass geschichtsrevisionistische Ansichten längst Einzug in unseren Alltag gehalten haben – teils mit abenteuerlichen Stilblüten, die mit Verschwörungstheorien eine gefährliche Gemengelage bilden und die Gesellschaft verändern. Sie begegnen Gedenkstätten wie Verlagen, wie ich es hier skizziert habe. Gelegentlich verirren sich Journalisten wie Jan Fleischhauer in fantastischen Erzählungen, die Narrative von einem linken Adolf Hitler bedienen! Als Trigger dient nicht selten die Ausstrahlung entsprechender Dokumentationen, wie beispielhaft über den Völkermord an den Herero in Deutsch-Südwestafrika. Das Internet und speziell die Nutzer sozialer Netzwerke dienen als tausendfache Multiplikatoren für krude Theorien und Narrative. Der Mausklick macht den Stammtisch entbehrlich.
Da ich berufsbedingt täglich viele Stunden auf Facebook und Co. verbringe, werde auch ich stets mit entsprechenden Botschaften konfrontiert. Als studierter Kunsthistoriker und Historiker bewege ich mich zwangsläufig in den entsprechenden Themenfeldern und Communitys, die Geschichtsrevisionisten anziehen. Erst vor wenigen Wochen hatte ich das zweifelhafte Vergnügen, von Andreas Harlaß, dem Sprecher der AfD Sachsen, angegangen zu werden. Herr Harlaß ist ein anschauliches Beispiel dafür, wie man relativierende Geschichtsnarrative in unsere Gesellschaft einsickern lässt. Auch er verbreitet die geschichtsrevisionistische These, Polen sei beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs der Aggressor gewesen und Hitler sei ihm mit einem Angriff nur zuvorgekommen. Fast noch aufschlussreicher für die ideologische Stoßrichtung des AfD-Funktionärs erscheinen mir kleine Gesten, wie das Facebook-Post eines Julleuchters, einer SS-Devotionalie par excellence, auf dem heimischen Weihnachtstisch.
Wie sehr revisionistische Ideen mittlerweile in die Mitte der Gesellschaft eingedrungen sind, zeigen fast banale tägliche Erfahrungen auf. Nur ein Beispiel unter vielen ist ein Internetnutzer, der sich Valjean72 nennt und immer wieder mit entsprechenden Kommentaren auf diversen Portalen auffällt. Er hat es sogar in die wissenschaftliche Analyse von Sarah Huber über Rechte Erzählungen im Netz geschafft, da er regelmäßig auf dem Blog der Sezession kommentiert. Valjean72 führt auch einen eigenen Blog ohne gültiges Impressum, auf dem er unter anderem geschichtsrevisionistische Ansichten über den Ersten und Zweiten Weltkrieg verbreitet. Seine pseudowissenschaftlichen Ausführungen belegt er gerne mit Autoren wie dem bereits oben erwähnten Stefan Scheil. Ich kenne unzählige Beispiele, bei denen die geschichtsverfälschenden Erzählungen eines Valjean72 oder eines beliebigen anderen Kommentators verfangen haben.
Schlussgedanke
Wissenschaftliche Expertise wird in neurechten Milieus gegen eine Ideologie eingetauscht, die nationalistisch geprägte Narrative bevorzugt. Diese neue Realität, welche einst selbstverständliche Standards bei der Vermittlung von Wissen und Bildung aushebelt, macht mir nicht nur als Geisteswissenschaftler Sorgen. Sie untergräbt zugleich das Fundament, auf dem unsere demokratische Gesellschaft aufgebaut ist: Vernunft, Aufklärung und ein faktenbasierter Dialog. Geschichtsrevisionismus und Verschwörungsmythen sind Bestandteil des Giftes, das eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft zersetzt. Deshalb kann es nicht nur Aufgabe der Wissenschaft sein, auf diese Missstände aufmerksam zu machen. Es braucht auch eine starke und aufgeklärte Zivilgesellschaft, um dem entgegenzutreten.




